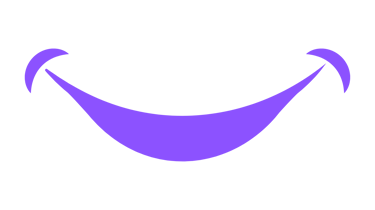Schuld
Was ist Schuld?
SHON GEWUSST
Aennipenni
9/25/20252 min read


Was ist Schuld?
Schuld bezieht sich aus psychologischer Sicht auf das Gefühl oder Bewusstsein, eine moralische oder soziale Norm verletzt zu haben. Damit ist Schuld eng verknüpft mit der Freiheit des Menschen, zu handeln und Verantwortung für sein Tun zu übernehmen. Viktor E. Frankl betont in seiner Logotherapie, dass der Mensch trotz äußerer Einflüsse geistig Stellung nehmen kann. Erst diese Freiheit zur Stellungnahme ermöglicht es uns, überhaupt schuldig zu werden.
Im Unterschied zur Scham, die sich stärker auf die eigene Person („Ich bin schlecht“) bezieht, richtet sich Schuld vordergründig auf eine bestimmte Handlung („Ich habe etwas Falsches getan“). Allerdings können Schuld und Scham beide als soziale Regulatoren wirken, indem sie uns helfen, unser Verhalten an gesellschaftlichen Normen auszurichten
Kann Schuld auch etwas Gutes bewirken – oder macht sie uns immer nur fertig?
Zwar wird Schuld oft als belastendes Gefühl wahrgenommen, das zu Rückzug, Reizbarkeit oder Scham führen kann. Doch Schuld kann zugleich etwas Positives bewirken, wenn wir:
Reue empfinden und Wiedergutmachung anstreben
Selbst aus negativen Aspekten wie Schuld kann ein Sinn gewonnen werden. Die Einsicht in eigenes Fehlverhalten ermöglicht Lernprozesse, Reue und Veränderung.
Verantwortung übernehmen
Schuldgefühle können auch ein Motor sein, um ungewünschtes Verhalten zu korrigieren. So bewahren wir unsere Würde und entwickeln persönliche Reife.
Das Gewissen als Kompass nutzen
In der Logotherapie beispielsweise wird das Gewissen als „Sinn-Organ“ beschrieben: Es hilft uns, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden und so künftige Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Allerdings kann Schuld in ihrer übersteigerten Form auch dazu führen, dass Menschen sich klein und nichtig fühlen und entweder in den „Kampf“ (Aggression) oder die „Flucht“ (Vermeidung) gehen. Um diese destruktive Dynamik zu entschärfen, ist ein bewusster Umgang mit Schuld – beispielsweise durch Selbstreflexion oder therapeutische Unterstützung – entscheidend.
Wie mit Schuld umgehen?
Der konstruktive Umgang mit Schuld umfasst mehrere Schritte:
Anerkennen und Reue zeigen. Nur wer sich eingesteht, etwas falsch gemacht zu haben, kann aufrichtig um Entschuldigung bitten oder Wiedergutmachung leisten.
Wiedergutmachung bzw. Sinn in der Schuld suchen
Das Leid, das durch eine schlechte Tat verursacht wurde kann eine tiefe innere Haltung der Reue aufzeigen und moralisch einen Wandel bewirken.
Verantwortung übernehmen statt Verdrängen
Wer seine Schuld lediglich verdrängt, läuft Gefahr, seelische Konflikte zu verstärken. Eine offene Auseinandersetzung erlaubt es, sich von introjizierten Schuldgefühlen, die oft aus Angst oder Fremdbestimmung entstehen, zu befreien.
Gewissen als „Sinn-Organ“ schulen
Ein reflektierter Umgang mit den eigenen Werten und Zielen stärkt den inneren Kompass. Dadurch werden Handlungen weniger impulsiv und stärker durch eine selbstbestimmte Haltung geleitet.
Insgesamt ist Schuld kein rein negatives Urteil von außen, sondern eng mit der Freiheit und Würde des Menschen verknüpft. Wir besitzen die Wahl, ob wir an unserer Schuld zerbrechen oder ob wir sie als Anlass nehmen, persönlich und moralisch zu wachsen.




Kontakt
office@mal-anders.com
© 2025. All rights reserved.