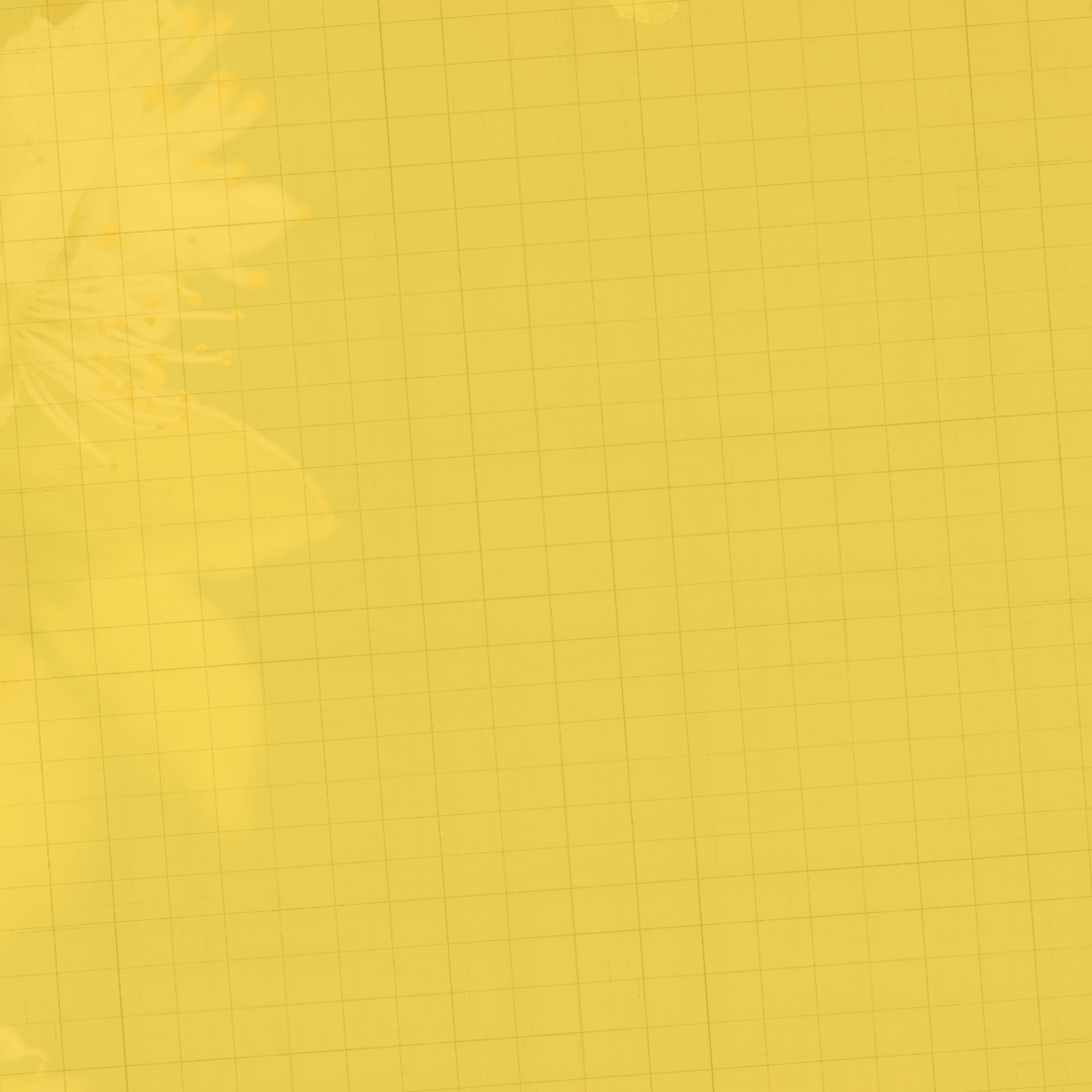
Bystander-Effekt
„Niemand hat mir geholfen?“ Warum lassen wir einen Rollstuhlfahrer 20 Minuten am Boden liegen, bevor wir ihm helfen? Was sagt so ein Verhalten über unsere Gesellschaft aus? Was verrät es uns über die Werte, die wir vertreten? Wie können wir das überwinden und mehr Zivilcourage in unserem Alltag verankern?
Mrs. Aennipenni
4/21/20253 min read
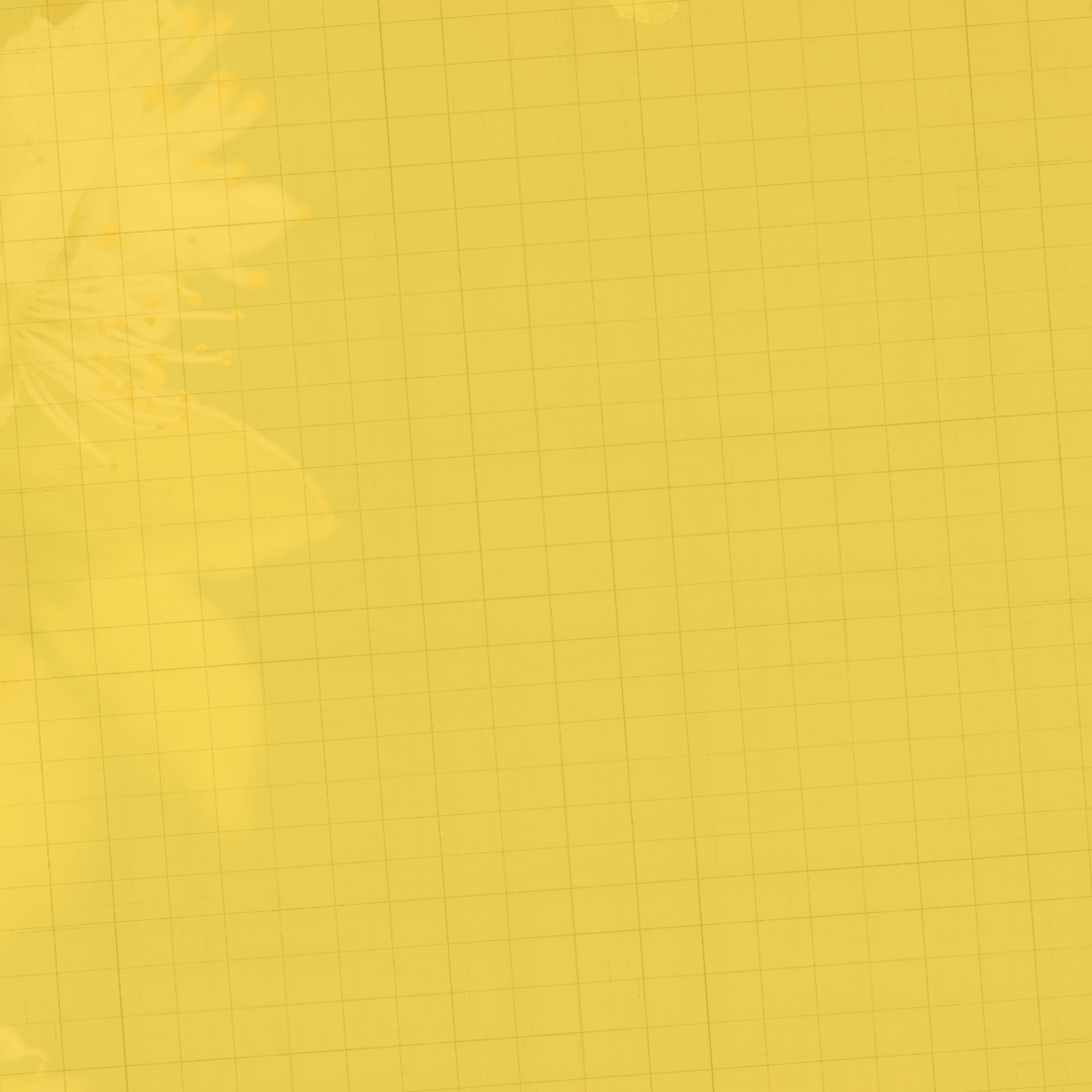
„Niemand hat mir geholfen?“ Warum lassen wir einen Rollstuhlfahrer 20 Minuten am Boden liegen, bevor wir ihm helfen?
Das beschriebene Verhalten lässt sich aus psychologischer Sicht primär durch den Bystander-Effekt („Zuschauer Effekt“) erklären (Latané & Darley, 1968). Menschen helfen seltener, wenn viele Zuschauer anwesend sind, da sie ihre persönliche Verantwortung auf die Gruppe projizieren (Verantwortungsdiffusion: „jemand anderes wird sicher helfen"). Dieser Effekt wird verstärkt durch die sogenannte pluralistische Ignoranz, bei der Einzelpersonen sich an der Reaktion der anderen orientieren und annehmen, dass kein Eingreifen erforderlich ist, wenn niemand handelt (Chekroun & Brauer, 2002). Zudem können gesellschaftliche Barrieren wie Angst vor Fehlinterpretationen, Unsicherheit über die richtige Vorgehensweise oder eigene emotionale Hemmungen eine Rolle spielen.


Was sagt so ein Verhalten über unsere Gesellschaft aus? Was verrät es uns über die Werte, die wir vertreten?


Das Phänomen offenbart eine Schwäche im sozialen Zusammenhalt und zeigt, dass viele Menschen zögern, sich öffentlich einzumischen. Dies kann auf mangelndes Verantwortungsbewusstsein und eine Individualisierung in der Gesellschaft zurückgeführt werden (Ostermann, 2004). Der öffentliche Raum sollte für alle Menschen sicher und frei zugänglich sein. Jeder Einzelne trägt Verantwortung dafür, diesen Raum zu schützen. Zivilcourage ist daher eine wichtige Eigenschaft in einer Demokratie. Es liegt nicht nur am Staat, sondern auch an jedem Bürger und jeder Bürgerin, den öffentlichen Raum zu verteidigen und die Werte von Menschlichkeit und Respekt in der Gesellschaft zu sichern (Ostermann, 2004).
Es unterstreicht die Bedeutung sozialer Normen und deren Einfluss auf unser Verhalten. Eine Gesellschaft, die Zivilcourage schätzt, sollte kollektive Werte wie Empathie, Solidarität und Verantwortungsgefühl fördern (Frey & Schnabel, 2007).
Zusätzlich verdeutlicht der Fall, dass es in einer pluralistischen Gesellschaft zunehmend wichtig ist, klare soziale Erwartungen an hilfsbereites Verhalten zu kommunizieren. Das Verhalten der Menschen wird stark durch die wahrgenommenen Reaktionen der anderen beeinflusst – wenn die Norm „Nicht-Eingreifen“ ist, wird sie tendenziell verstärkt.
Gibts Hinweise? Prävention und Früherkennung
Bildung und Aufklärung: Zivilcourage sollte bereits in Schulen und in der Öffentlichkeit gefördert werden. Trainingsprogramme können helfen, Hemmungen abzubauen und den Umgang mit Notsituationen einzuüben
Normen stärken: Öffentlich sichtbare Kampagnen, die positives Eingreifen loben und verbreiten, können soziale Normen für Hilfeverhalten stärken. Wenn Menschen erkennen, dass Zivilcourage geschätzt wird, werden sie eher eingreifen
Bewusstsein schärfen: Geschichten und Fälle, sowie der Fall der in unserem Podcast mit Roman Schlauer besprochen wurde (hier gehts zum Podcast ) können genutzt werden, um die Konsequenzen des Wegsehens zu verdeutlichen. Solche Fälle könnten emotionale Betroffenheit erzeugen, die nachweislich die Motivation zum Handeln steigert.
Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Gemeinschaften sollten den sozialen Kontakt und den Austausch fördern, um das Verantwortungsgefühl füreinander zu stärken. Menschen helfen eher, wenn sie sich verbunden fühlen.
Politische Maßnahmen: Es könnte gesetzliche Anreize oder Schulungen geben, die Bürger in Erste-Hilfe-Kenntnissen und dem Umgang mit Konflikten schulen. Solche Maßnahmen können das Selbstbewusstsein stärken, einzuschreiten.
Empathie kann ebenfalls ein entscheidender Faktor für zivilcouragiertes Verhalten sein. Lies hier weiter was Empathie ist. (hier gehts zum Beitrag über Empathie)


Zitation:
Chekroun, P., & Brauer, M. (2002). The bystander effect and personal responsibility in deviant behaviors. Journal of Social Psychology, 142(6), 715–728.
Festl, M. (2009). Dominik B.: Der tragische Held der Münchner S-Bahn. Süddeutsche Zeitung.
Frey, D., & Schnabel, D. (2007). Zivilcourage-Trainings: Effekte auf Gewalt und Bullying in Schulen. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 39(3), 123–135.
Latané, B., & Darley, J. M. (1968). Group inhibition of bystander intervention in emergencies. Journal of Personality and Social Psychology, 10(3), 215–221.
Ostermann, H. (2004). Zivilcourage: Eine Tugend für die Demokratie. Zeitschrift für Politik und Gesellschaft, 15(2), 45–60.
TIWAG (2010). Fall Alois Partl: Passanten ignorieren Verletzten. Tiroler Wasserwerke Jahresbericht.
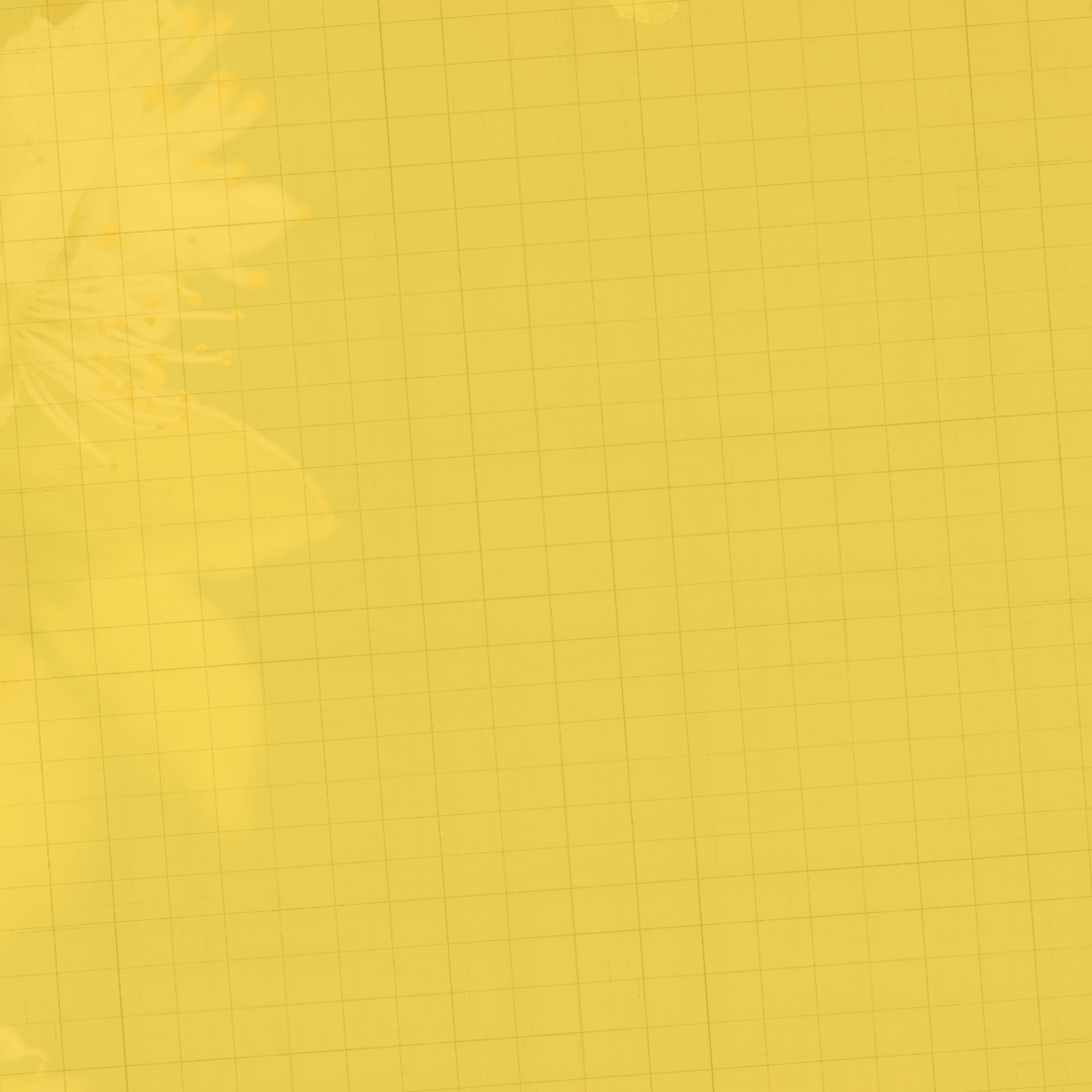
Verbindung
Kreative Plattform für Kunst und Austausch.
© 2024. All rights reserved.
weitere Infos folgen - so weit sind wir noch nicht
